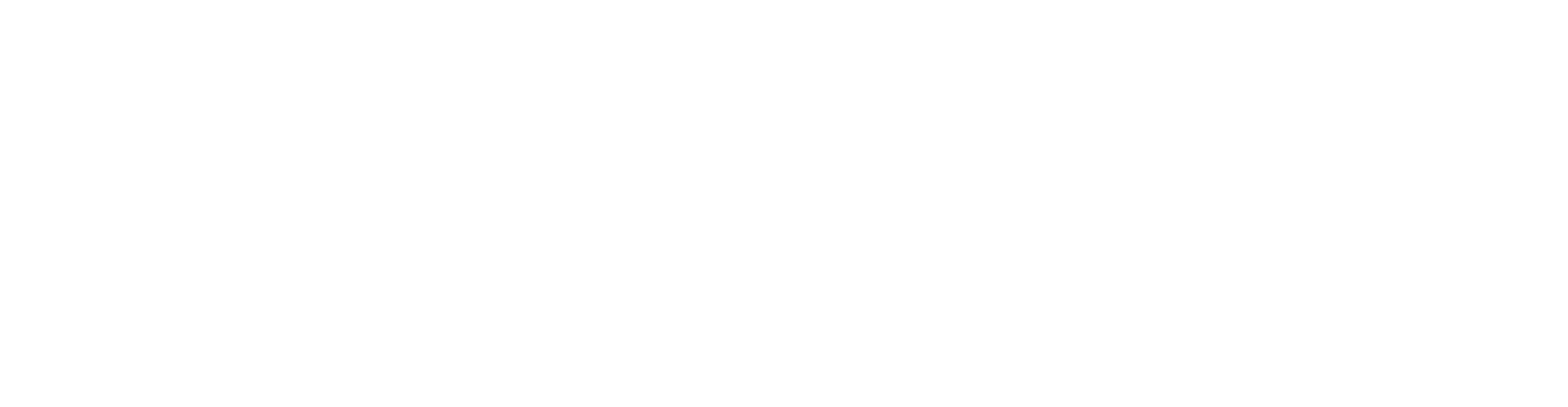„Um Lebendes zu erforschen, muss man sich am Leben beteiligen.“
Viktor von Weizsäcker.
Der Gestaltkreis. 1940
Der Gestaltkreis (1932/1940)
Natur und Geist (1944)
Pathosophie (1956)
Matthias Wiehle
Literatur und Links
Viktor von Weizsäcker Gesellschaft. Werke, Sekundärliteratur und weiterführende Texte. https://viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/index.php?id=1
Hoffmann SO. Viktor von Weizsäcker: Arzt und Denker gegen den Strom. Dtsch Arztebl 2006; 103(11): A-672 / B-577 / C-557 https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=50616
Hühnerfeld P. Die Theorie ist nicht nur grau. Zu medizin-philosophischen Büchern von Leibbrand, Weizsäcker und Binswanger. DIE ZEIT 1956, Nr. 8. https://www.zeit.de/1956/32/die-theorie-ist-nicht-nur-grau
Rimpau W (Hrsg.). Viktor von Weizsäcker. Warum wird man krank? - Ein Lesebuch. Suhrkamp 2008 https://www.suhrkamp.de/buecher/warum_wird_man_krank_-viktor_von_weizsaecker_45936.html
Schmincke B. Viktor von Weizsäcker (1886–1957). Biogramm. In: Ebke T, Schloßberger M. Dezentrierungen: Zur Konfrontation von Philosophischer Anthropologie, Strukturalismus und Poststrukturalismus. Sonderdruck aus: Accarino B, de Mul J, Krüger HP. Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Akademie Verlag Berlin 2011/2012, S. 279, 284 und 292. https://viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/assets/pdf/Biogramm_Viktor_von_Weizsaecker.pdf
Stoffels H, Achilles P. Anmerkungen zum Streitfall: Viktor von Weizsäcker und der Nationalsozialismus. https://viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/mitt_mehr.php?id=8&sID=4
Benzenhöfer U. Der Arztphilosoph Viktor von Weizsäcker. Leben und Werk im Überblick. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007.
Viktor von Weizsäcker Gesellschaft. Biographie. https://viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/biographie.php?id=2
von Weizsäcker V. Gesammelte Schriften in zehn Bänden - 1. Natur und Geist. Begegnungen und Entscheidungen. Suhrkamp, Berlin 1986. https://www.suhrkamp.de/buecher/gesammelte_schriften_in_zehn_baenden-viktor_von_weizsaecker_57720.html
von Weizsäcker V. Gesammelte Schriften in zehn Bänden - 4. Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen. Suhrkamp, Berlin 1997. https://www.suhrkamp.de/buecher/gesammelte_schriften_in_zehn_baenden-viktor_von_weizsaecker_57779.html
von Weizsäcker V. Gesammelte Schriften in zehn Bänden - 9. Fälle und Probleme. Klinische Vorstellungen. Suhrkamp Berlin, 1988. https://www.suhrkamp.de/buecher/gesammelte_schriften_in_zehn_baenden-viktor_von_weizsaecker_57795.html
von Weizsäcker V. Gesammelte Schriften in zehn Bänden - 10. Pathosophie. Suhrkamp Berlin 2005. https://www.suhrkamp.de/buecher/gesammelte_schriften_in_zehn_baenden-viktor_von_weizsaecker_57799.html
Wiedebach H. Die Pathosophie Viktor von Weizsäckers. Mitteilungen der Viktor von Weizsäcker Gesellschaft. Fortschr Neurol Psychiat 2011; 79: 745–56 https://viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/assets/pdf/Mitteilungen_Nr29_11.pdf?id=8
Gahl KPG. Anthropologische Medizin als klinische Wissenschaft. Ethik in der Medizin 2011, 23: 67–71. https://www.viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/assets/pdf/Menschenbild_med_Anthropologie.pdf
Jacobi RME. Zum Menschenbild der medizinischen Anthropologie – eine Einführung. https://www.viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/assets/pdf/Menschenbild_med_Anthropologie.pdf
Wiedebach H. Skizze einer pathischen Ethik. https://www.viktor-von-weizsaecker-gesellschaft.de/assets/pdf/Menschenbild_med_Anthropologie.pdf