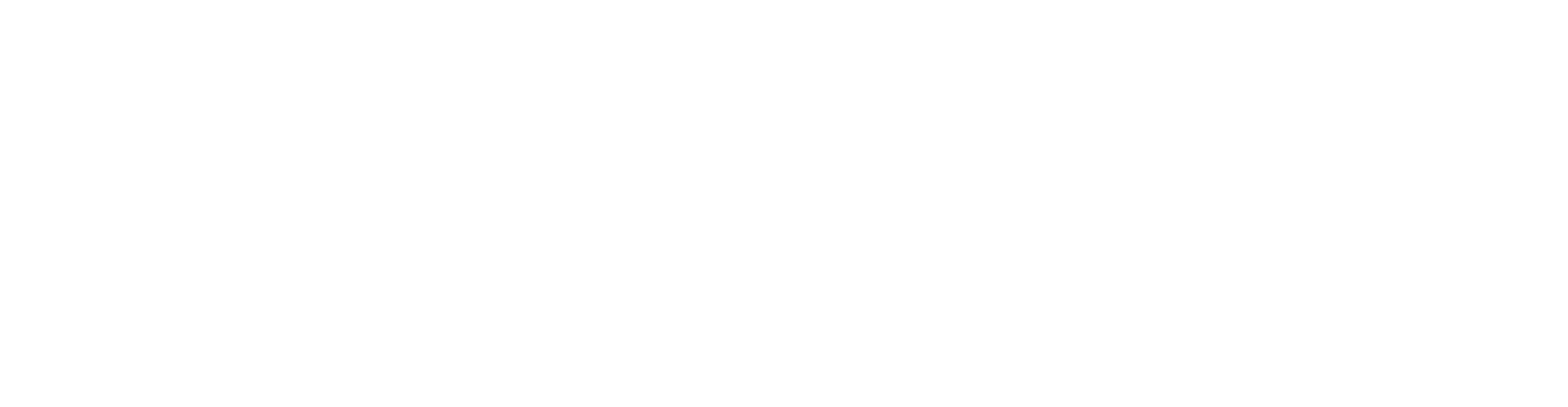ICH UND DU: SUBJEKT SEIN
Standardisierte Fakten- und Spezialistenmedizin hat viele Vorteile
Ärzte mit Deutungshoheit, Kranke als Objekte, Patienten als Konsumenten
Die Wiedereinführung des Subjekts in die Medizin – diagnostisch und therapeutisch
“Non homo universalis curatur sed unusquisque nostrum.”
“Wir behandeln nicht einen generellen Menschen, sondern einen bestimmten, einzigartigen, unseren.“
Galen, 2.Jh. n.Chr.
"Der alte Arzt spricht Latein. Der junge Arzt spricht Englisch. Der gute Arzt spricht die Sprache des Patienten.“
Ursula Lehr, 1988-1991 dt. Gesundheitsministerin
Constanze Hausteiner-Wiehle
Literatur und Links
Arroll B, Allen EC. To self-disclose or not self-disclose? A systematic review of clinical self-disclosure in primary care. Br J Gen Pract. 2015;65(638):e609-16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4540401/pdf/bjgpsep-2015-65-638-e609.pdf
Balint M. Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. 12. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta 2019. https://www.klett-cotta.de/buch/Psychoanalyse/Der_Arzt_sein_Patient_und_die_Krankheit/13252
Bensing J, Rimondini M, Visser A. What patients want. Patient Educ Couns. 2013;90(3):287-90. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399113000177?via%3Dihub
Dörner K. Gesundheitssystem: In der Fortschrittsfalle. Dtsch Arztebl 2002; 99 (38): A 2462–2466. https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=33941
Hausteiner-Wiehle C, Henningsen P. Subjektivität und Objektivität, Kranksein und Krankheit. Nervenarzt. 2019 Dec 19. doi: 10.1007/s00115-019-00860-5. https://www.springermedizin.de/subjektivitaet-und-objektivitaet-kranksein-und-krankheit/
Nagel T. What is it like to be a bat? In: The Philosophical Review. Cornell University, Ithaca 83/1974, S. 435–450. https://web.archive.org/web/20071024145103/http://members.aol.com/NeoNoetics/Nagel_Bat.html
Roenneberg C, Sattel H, Schaefert R, Henningsen P, Hausteiner-Wiehle C. Funktionelle Körperbeschwerden. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 553-60. https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=209277
Sharpe M, Greco M. Chronic fatigue syndrome and an illness-focused approach to care: controversy, morality and paradox. Med Humanit. 2019;45(2):183-187. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6699605/pdf/medhum-2018-011598.pdf
Tye M. Qualia. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 18.12.2017.
https://plato.stanford.edu/entries/qualia/