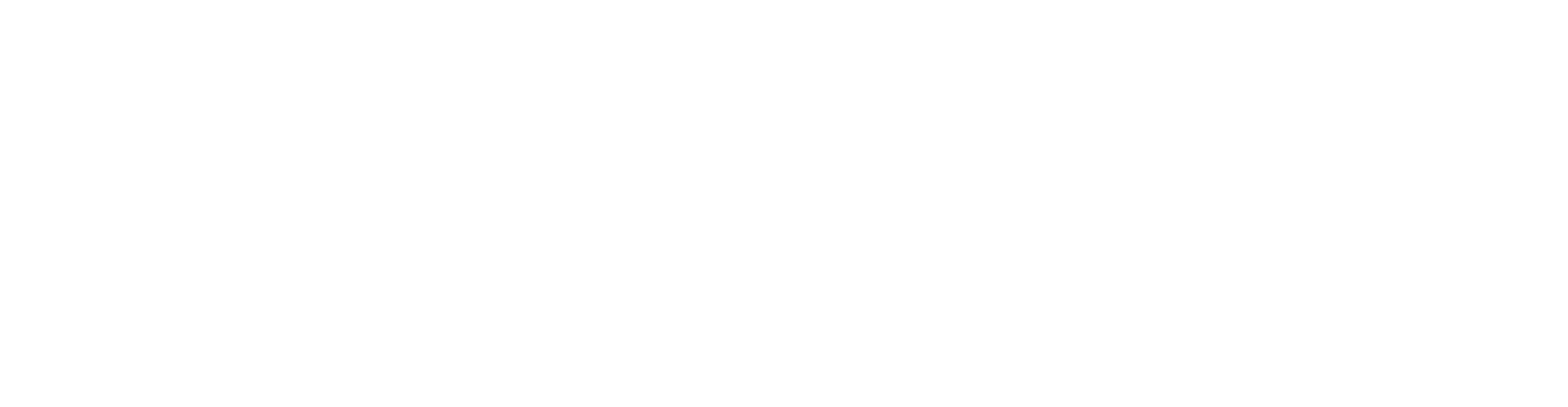BITTE ANFASSEN -
BERÜHRUNG UND GESUNDHEIT
„Was uns nicht berührt, das verwandelt uns nicht.“
Carl Gustav Jung
WAS BERÜHRT MICH?
BERÜHRUNG
ALS BEDROHUNG
Constanze Hausteiner-Wiehle
und Peter Henningsen
LITERATUR UND LINKS
Cascio CJ, Moore D, McGlone F. Social touch and human development. Dev Cogn Neurosci. 2019;35:5-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6968965/pdf/main.pdf
Cocksedge S, George B, Renwick S, Chew-Graham CA. Touch in primary care consultations: qualitative investigation of doctors' and patients' perceptions. Br J Gen Pract. 2013;63(609):e283-90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609476/pdf/bjgp-april2013-63-609-e283.pdf
Conde-Agudelo A, Díaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2016(8):CD002771. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464509/pdf/CD002771.pdf
Derksen F, Bensing J, Lagro-Janssen A. Effectiveness of empathy in general practice: a systematic review. Br J Gen Pract. 2013;63(606):e76-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3529296/pdf/bjgp63-e76.pdf
Harlow HF, Dodsworth RO, Harlow MK. Total social isolation in monkeys. Proc Natl Acad Sci USA. 1965;54(1):90-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC285801/pdf/pnas00159-0105.pdf
Harlow HF, Zimmermann RR. Affectional responses in the infant monkey; orphaned baby monkeys develop a strong and persistent attachment to inanimate surrogate mothers. Science 1959;130(3373):421-32.
Kelly M, Tink W, Nixon L, Dornan T. Losing touch? Refining the role of physical examination in family medicine. Can Fam Physician. 2015;61(12):1041-3, e532-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677934/pdf/0611041.pdf
Nelson CA 3rd, Zeanah CH, Fox NA. How Early Experience Shapes Human Development: The Case of Psychosocial Deprivation. Neural Plast 2019:1676285
Rousseau PC, Blackburn G. The touch of empathy. J Palliat Med. 2008;11(10):1299-300.
Russo V, Ottaviani C, Spitoni GF. Affective touch: A meta-analysis on sex differences. Neurosci Biobehav Rev. 2020;108:445-452.
Singh C, Leder D. Touch in the consultation. Br J Gen Pract. 2012;62(596):147-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289810/pdf/bjgp62-147.pdf
Suvilehto JT, Glerean E, Dunbar RIM, Hari R, Nummenmaa L. Topography of social touching depends on emotional bonds between humans. Proc Natl Acad Sci USA. 2015;112(45): 13811–13816. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4653180/pdf/pnas.201519231.pdf
Suvilehto JT, Nummenmaa L, Harada T, Dunbar RIM, Hari R, Turner R, Sadato N, Kitada R. Cross-cultural similarity in relationship-specific social touching. Proc Biol Sci. 2019;286(1901): 20190467. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6501924/pdf/rspb20190467.pdf
Wilkinson H, Whittington R, Perry L, Eames C. Examining the relationship between burnout and empathy in healthcare professionals: A systematic review. Burn Res. 2017;6:18-29. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2213058617300025?token=7C5CCBC24986FAE6205745152A8A1F47268B023BBA8C8247BB191084C0FF3262CED486CE38F75AA57AF9B0263A74F33B