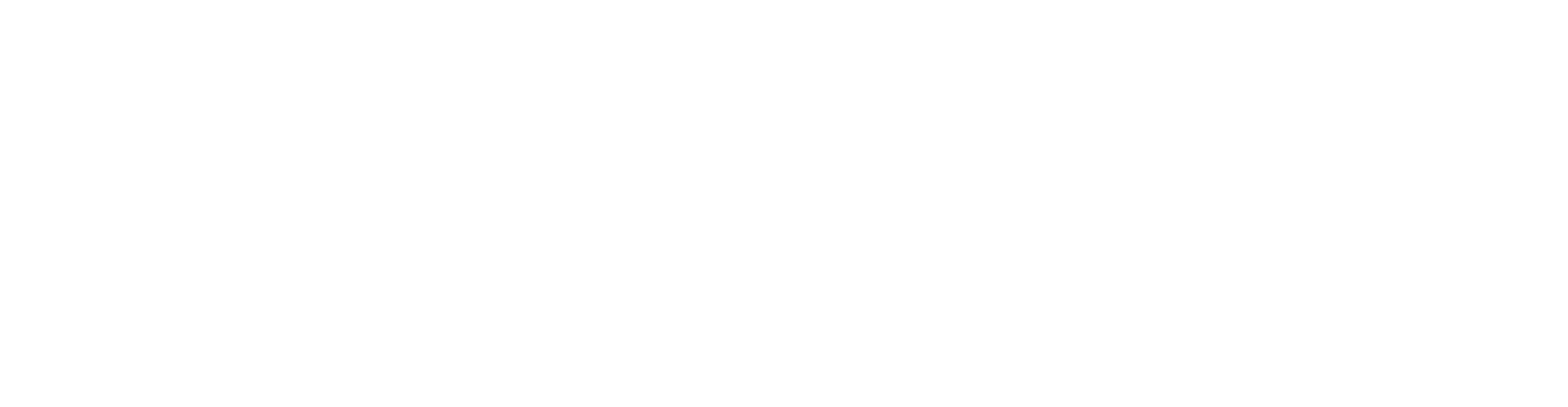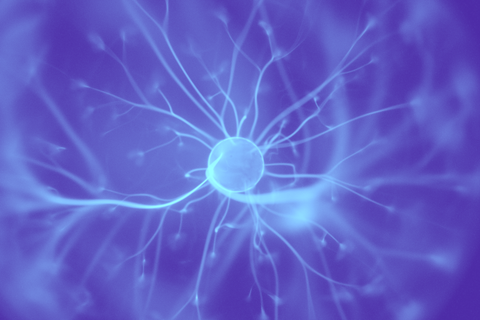LEBENDIG SEIN
„Leben ist die Grundlage, die den Ausgang der Philosophie bilden muss.
Es ist das von innen Bekannte, es ist dasjenige, hinter welches nicht zurückgegangen werden kann.
Das Leben kann nicht vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht werden.“
Wilhelm Dilthey
Homöostase und Allostase - auf allen Ebenen
Regeneration und Reparatur
Leben und Tod
Leben und Gefahr
Leben und Geist: "Mind in Life"
Ökologie
Bedeutung für die Medizin - nicht nur für die anthropologische
*Es ist allerdings umstritten, ob Viren zu den „Lebewesen“ gehören, denn sie nutzen ja Stoffwechsel und Fortpflanzungsmöglichkeiten ihres Wirts. Obwohl sie nur aus DNA bzw. RNA und einer Proteinhülle bestehen, sind sie zum Teil erstaunlich stabil. Innerhalb von Wirtszellen replizieren sie sich so schnell und zahlreich, dass sie hohe Mutationschancen bzw. -risiken haben. In der Gentechnik werden virale Vektoren verwendet, um genetisches Material in Zellen zu einzubringen. Dank ihrer Wandelbarkeit werden Viren für den Menschen mal gefährlicher, mal harmloser; mit unseren Gegenmaßnahmen hinken wir immer hinterher. Viren, diese ubiquitär vorhandenen Erbgut-Überraschungs-Päckchen, greifen in die Evolution als Entwicklungs-Booster, Regulierer und Zerstörer ein.
**Die seltene, durch Prionen übertragene und vererbbare letale familiäre Insomnie ist eine spongiforme Enzephalopathie, die nach spätestens zwei Jahren zum Tod führt. Es gibt aber auch das Phänomen des so genannten „Halbhirnschlafs“ (unihemispheric slow-wave sleep, USWS), z.B. bei Delfinen, Walen und Vögeln: Nur eine der beiden Gehirnhälften schläft, nur ein Auge wird geschlossen, während die andere aktiv bleibt und die Umgebung weiter wahrgenommen werden kann. Praktisch, nicht wahr?
***Die älteste bekannte tierische Zelllinie ist vermutlich das Sticker-Sarkom, ein vermutlich tausende Jahre alter infektiöser Hunde-Genitaltumor natürlichen Ursprungs; die älteste menschliche Zelllinie („HeLa“) stammt aus dem Cervixkarzinom der 1951 verstorbenen Amerikanerin Henrietta Lacks.
Constanze Hausteiner-Wiehle
und Matthias Wiehle
Literatur und Links
Bar-On YM, Phillips R., Milo R. The biomass distribution on Earth. PNAS 2018;115(25):6506-6511. https://www.pnas.org/content/pnas/115/25/6506.full.pdf
Bergmann O, Zdunek S, Felker A, Salehpour M, Alkass K et al. Dynamics of Cell Generation and Turnover in the Human Heart. Cell 2015; 161(7):1566-75
Cannon WB. The Wisdom of the Body. WW Norton, New York 1932
Cannon WB. Voodoo Death. Am Anthropol 1942;44:169–181 und Am J Public Health 2002;92(10):1593-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447285/pdf/0921593.pdf
Corcoran AW, Hohwy J. Allostasis, interoception, and the free energy principle: Feeling our way forward. In: Tsakiris M, de Preester H. The Interoceptive Mind: From Homeostasis to Awareness. Oxford University Press 2018 https://www.researchgate.net/publication/320677836_Allostasis_interoception_and_the_free_energy_principle_Feeling_our_way_forward
Jonas H. Das Prinzip Leben. Suhrkamp, Berlin 2011
Kirchhoff M, Froese T. Where There is Life There is Mind: In Support of a Strong Life-Mind Continuity Thesis. Entropy 2017;19(4):169. https://www.researchgate.net/publication/316190653_Where_There_is_Life_There_is_Mind_In_Support_of_a_Strong_Life-Mind_Continuity_Thesis
Lahav N. Biogenesis - Theories of Life's Origin. New York 1999.
Lee SW. A Copernican Approach to Brain Advancement: The Paradigm of Allostatic Orchestration. Front Hum Neurosci. 2019;13:129. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6499026/pdf/fnhum-13-00129.pdf
Max-Planck-Gesellschaft. Leben ist Ansichtssache. https://www.synthetische-biologie.mpg.de/17480/was-ist-leben
McEwen BS, Wingfield JC. The concept of allostasis in biology and biomedicine. Hormones and Behavior 2003;43:2–15
McEwen BS. Stressed or stressed out: what is the difference? J Psychiatry Neurosci. 2005;30(5):315-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1197275/pdf/20050900s00002p315.pdf
Rosentreter M, Groß D, Kaiser S. Sterbeprozesse – Annäherungen an den Tod. Kassel University Press 2010. https://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-960-3.volltext.frei.pdf
Saha T, Galic M. Self-organization across scales: from molecules to organisms. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2018;373(1747):20170113. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904299/pdf/rstb20170113.pdf
Schweitzer A. Ehrfurcht vor dem Leben. München, CH Beck 2013
Thompson E. Life and mind: From autopoiesis to neurophenomenology. A tribute to Francisco Varela. Phenomen Cogn Sci 2004;3:381-398. https://evanthompsondotme.files.wordpress.com/2012/11/pcs-life-and-mind.pdf
Thompson E. Mind in Life. Biology, Phenomenology and the Sciences of Mind. Harvard University Press 2007
Wedlich-Söldner R, Betz T. Self-organization: the fundament of cell biology. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2018;373(1747):20170103. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5904291/pdf/rstb20170103.pdf
Verwer K. Freiheit und Verantwortung bei Hans Jonas. Universität Berlin, 2011 http://creativechoice.org/doc/HansJonas.pdf