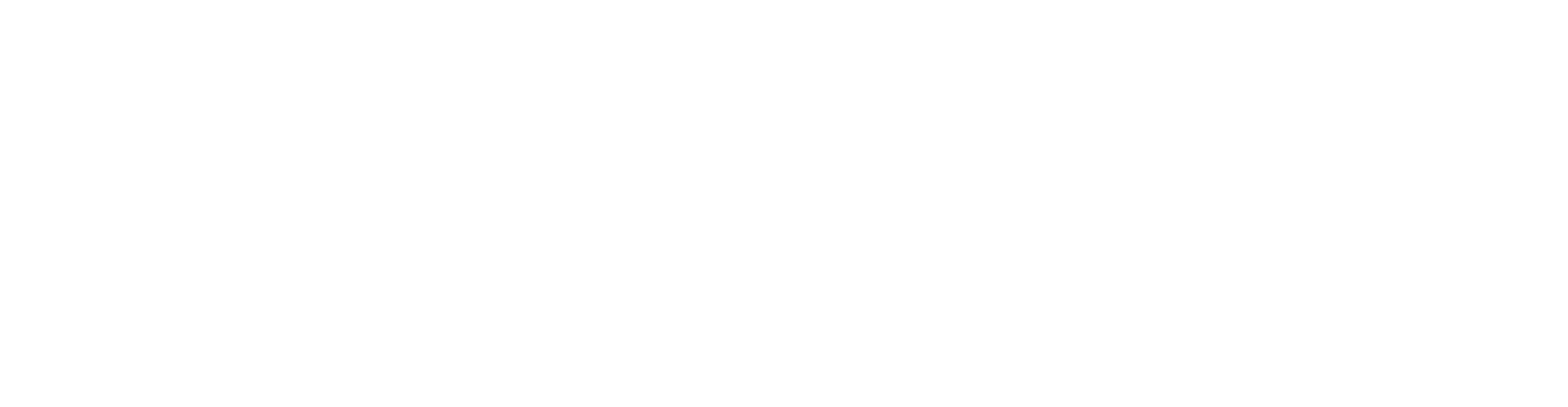EINGEBUNDEN SEIN: EMBEDDED!
„Wir sehen in der Natur nie etwas als Einzelheit,
sondern wir sehen alles in Verbindung mit etwas anderem,
das vor ihm, neben ihm, hinter ihm, unter ihm und über ihm sich befindet.“
Johann Wolfgang von Goethe, zu Eckermann, 1826
Wir Menschen sind daran gewöhnt, uns als einzelne (manchmal auch als vereinzelte) Wesen zu begreifen. Das ist gut so, denn anders als Bäume im Wald, Bienen im Bienenstock und selbst Schafe in einer Schafherde, sind wir verhältnismäßig autonom, also handlungsfähig und vor allem auch handlungswillig. Wir haben ein Selbst-Bewusstsein und eine eigene Identität, die aus unserer Lebensgeschichte erwächst, die wir bewusst formen und auf deren Einzigartigkeit wir stolz sind. Auch wenn es auch in unseren westlichen Gesellschaften Normen und Vorurteile gibt: Der hohe Wert des einzelnen Individuums erlaubt viele Verschiedenheiten, die in der Summe den Reichtum einer Gesellschaft ausmachen. Er schützt uns vor Gleichmacherei, vor Austauschbarkeit und vor Ausgrenzung: Everyone matters, wir sind alle Unikate.
Allerdings gehen dabei einige Aspekte verloren, vor allem der der Gemeinsamkeit, des Eingebunden- und des Aufgehobenseins, wie sie Menschen in kollektivistischen Gesellschaften kennen (freilich nur, solange sie die Normen erfüllen). Vor allem aber ignoriert die Annahme, dass die Welt eine Bühne voller unabhängig voneinander agierenden Individuen sei, eine ganze Reihe von Fakten:
- Lebewesen brauchen ein Milieu und Nährstoffe.
- Die meisten Lebewesen brauchen andere Lebewesen für Aufzucht, Schutz und Entwicklung.
- Der Mensch mit seiner langen Kindheit, seinem Stoffwechsel (mit vielen essenziellen Nährstoffen und Aminosäuren) und seinem sehr plastischen Gehirn ist dabei sogar ganz besonders von anderen abhängig.
- Sprache, Geschichten und (Vor-)Bilder, die ja gerade dem Menschen deutlich mehr Freiheitsgrade ermöglichen als die Rhythmen, Rangordnungen und Instinkte anderer Lebewesen, entstehen im und wiederum für den Austausch mit anderen sprechenden und bildenden Menschen.
„No man is an island, entire of itself.“
„Niemand ist eine Insel, in sich ganz.“
John Donne, Meditation XVII, 1623
Daher hat sich unser Bild vom Menschen gewandelt. 400 Jahre nach Descartes verstehen wir uns (wieder) auch aus unserer Entwicklungsgeschichte, aus unserer Körperlichkeit, aus unseren Erfahrungen und Beziehungen, aus unserer permanenten Interaktion mit unserer (sozialen) Umwelt heraus. Jeder Organismus kommt woanders her und geht einen anderen Weg. Gerade dadurch entsteht Individualität, aber eben keine losgelöste und unabhängige, sondern eine verbundene und eingebettete.
So prägt mein individueller psychosozialer Kontext – von frühen Beziehungserfahrungen bis zur aktuellen Wohn- und Finanzsituation – die Art und Weise, wie ich mich selbst und andere sehe, meine Werte, meine Vorurteile, meine oft erstaunlich automatisierten Gedanken, Gefühle und Handlungen. Solche „Muster“ können sogar ganze Familien und Nationen prägen. So wird aus jeder einzelnen neuen Situation ein kaum vorhersehbares, manchmal fruchtloses, oft fruchtbares, zuweilen explosives Gemisch: In der Wahrnehmung meines aktuellen Gegenübers mischt sich der Anteil, den das Gegenüber einbringt, mit dem des Kontexts, der sowohl das Verhalten des Gegenübers wie meine Wahrnehmung mitprägt, mit dem Anteil an Wahrnehmungsbereitschaften, der aus früheren ähnlichen Erfahrungen stammt. Beispielsweise kann ein leicht provokatives Verhalten, das unter normalen Umständen beim Gegenüber maximal ein Stirnrunzeln hervorrufen würde, in einer angespannten Situation sowohl stärker ausfallen wie als stärker wahrgenommen werden – und wenn der Wahrnehmende dann noch unangenehme Vorerfahrungen mit provokativem Verhalten hatte, ist die eskalierende Reaktion erst recht programmiert.
Bedeutung für die Medizin
Auch in der Medizin erweitert sich der Fokus zum Glück langsam etwas, wenn auch bisher nur in kleinen und durchaus immer wieder mit Rück-Schritten. Anstatt allein der Körper werden zunehmend auch Subjektivität und Kontext als entscheidende Faktoren bei der Entstehung von Krankheit und bei der Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Gesundheit erkannt. Sie gelten nicht mehr nur als Störfaktoren, die es – vermeintlich im Dienst von Objektivität und Wissenschaftlichkeit – abzustreifen gilt. Denn eine isolierte Betrachtung des kranken Menschen als alleiniger Fokus jeglicher Analysen und Interventionen führt unweigerlich zu einem schiefen oder unvollständigen Bild: Man wird den Diabetes eines Menschen besser einstellen können, wenn man weiß, welche Rolle Trost durch Süßes in seiner Familie spielt oder welche Ernährung ihm in seiner Flüchtlingsunterkunft überhaupt möglich ist.
Auch in Arzt-Patient-Beziehungen sind wir jedes Mal aufs Neue eingebettet, jede davon verändert den Patienten und jede davon verändert uns. Zur faktischen Kommunikation mit ihren verbalen und nonverbalen Anteilen kommt das Beziehungserleben aller Beteiligten hinzu. Und das wiederum ist nicht nur geprägt von der aktuellen, realen Beziehung, sondern genauso von früheren Beziehungserfahrungen. Wichtig ist für den Arzt, die Ärztin also mindestens zweierlei: zunächst Kompetenz in Gesprächsführung, die zuallererst Kompetenz im aktiven Zuhören ist – und dann die Fähigkeit, Auswirkungen früherer Beziehungserfahrungen auf die aktuelle Beziehung bei sich und beim anderen wahrzunehmen, im psychoanalytischen Jargon als Übertragung und Gegenübertragung bezeichnete Phänomene. Eingebettetsein bedeutet auch, dass Anamnesen selbst dann wichtige Beziehungsepisoden beschreiben können, wenn es auf Anhieb gar nicht so wirkt. So wird z.B. jede Aufzählung von Krankheiten und Beschwerden auch zu einem Bericht über die Beziehungserfahrungen mit Ärzten, Angehörigen, Kollegen und Freunden etc., die im Umgang mit diesen Beschwerden stattgefunden haben und die das Erleben des Patienten oft mindestens so bestimmen wie die Beschwerden und Krankheiten selbst. Und dass dann therapeutisch die „Droge Arzt“ über das Eingebettetsein des Patienten in die aktuelle Beziehung zu diesem Arzt wirkt, dürfte bis hierhin schon klar geworden sein…
Und schließlich: Nicht nur junge Ärzte lernen am meisten von Ihren Patienten, ihren Vorbildern, aus ihren Fehlern. Entscheiden wir am Anfang unseres Berufswegs oft noch schematisch nach Algorithmen und Lehrbuchwissen (zum Glück aufgefangen in einem Netz aus Erfahrungswissen ihrer Kollegen), so erreichen wir im Laufe der Jahre mehr und mehr „pattern recognition“ aus Erfahrungen, verfügen über ein stabiles Netz aus bewährten Kontakten und trauen uns, im Einzelfall von Standard begründbar und nachvollziehbar abzuweichen.
Peter Henningsen und Constanze Hausteiner-Wiehle
Literatur und Links
Bettighofer S. Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozess. Kohlhammer, Stuttgart 2016
Hausteiner-Wiehle C, Schaefert R. Interaktionsverhalten von Patienten mit Behandlern und Angehörigen. und: Gestaltung der Arzt-/Therapeut-Patient-Beziehung und Gesprächsführung. In: Rief W, Henningsen P. Psychosomatik und Verhaltensmedizin. Schattauer, Stuttgart 2015
Newen A, de Bruin L, Gallagher S. Oxford Handbook of 4E Cognition. Oxford University Press, Oxford 2018